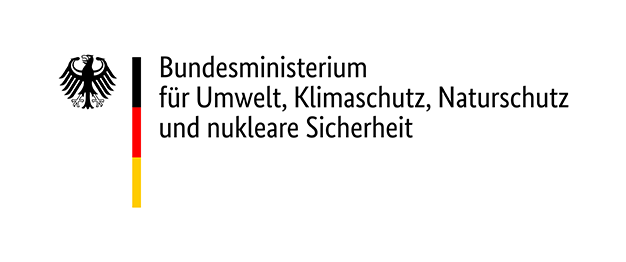Im Jahr 2024 veröffentlichten unsere F.R.A.N.Z. Kollegen Dr. Jannik Beninde und Dr. Philip Hunke vom Michael-Otto-Institut im Nabu (MOIN) eine wissenschaftliche Studie im Journal of Ornithology. Diese Untersuchung beleuchtet die Bedeutung von Feldlerchenfenstern für den Erhalt und Förderung der bedrohten Feldlerche (Alauda arvensis) und bietet wertvolle Einblicke in die Optimierung von Lebensräumen für die Feldlerche in der intensiv genutzten Agrarlandschaft Deutschlands.
Hintergrund
Die Feldlerche, ein charakteristischer Bewohner der europäischen Agrarlandschaft, ist in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich aufgrund intensiver Bewirtschaftung stark zurückgegangen. Dichte und Höhe insbesondere des Wintergetreides verschlechtern die Habitatbedingungen der Feldlerchen. Die Studie von Dr. Beninde und Dr. Hunke zielt darauf ab, die Feldlerchenfenster, die den Lebensraum und die Brutbedingungen für die Feldlerche verbessern soll, auf ihre Wirksamkeit zu untersuchen. Die Forschung wurde auf den F.R.A.N.Z. Betrieben durchgeführt, die sich durch unterschiedliche Boden- und Anbaubedingungen auszeichnen.
Material und Methode
Dr. Beninde und Dr. Hunke führten ihre Untersuchungen zwischen 2017 und 2023 im Rahmen des F.R.A.N.Z.-Projekts durch, wobei sie die Effektivität der Feldlerchenfenstern analysierten. Diese Fenster sind ungesäte Bereiche von 20 m² innerhalb von Getreidefeldern, die speziell für die Feldlerche angelegt werden. Die Studie untersuchte den Einfluss verschiedenster Faktoren, wie die Vielfalt der umliegenden Kulturen, die Wetterbedingungen oder die Größe von Blühstreifen auf die Effektivität dieser Fenster. Daten wurden durch direkte Beobachtungen im Feld zur Brutzeit der Feldlerchen von März bis Juli erhoben.
Ergebnisse und Fazit
Die Ergebnisse zeigen, dass Feldlerchenfenster im Durchschnitt eine Steigerung der Feldlerchensichtungen von 15% ermöglichen, bei einer Nutzung von nur 0,4% der landwirtschaftlichen Fläche. Signifikant positiv beeinflusst wird die Effektivität der Feldlerchenfenster durch die Vielfalt der umliegenden Kulturen in der Umgebung. Der Abstand und die Größe von Blühstreifen innerhalb eines 250 m Radius zeigte hingegen gemischte Effekte auf die Wirksamkeit der Feldlerchenfenster, weshalb diese nicht in Kombination umgesetzt werden müssen. Während andere Maßnahmen wie brachliegende Felder noch effektiver sein können, bietet die Anlage von Feldlerchenfenstern für die Landwirtschaft eine kostengünstige und risikoarme Möglichkeit, die Feldlerche zu unterstützen. Diese Erkenntnisse könnten zukünftig als Grundlage für umweltfreundlichere landwirtschaftliche Praktiken dienen, um den Schutz der Feldlerche zu verbessern.
Sie finden die Studie frei verfügbar auf Englisch mit deutscher Zusammenfassung unter dem folgenden Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10336-024-02222-8
https://doi.org/10.1007/s10336-024-02222-8
Die Verteilung von Feldlerchenfenstern auf dem Demonstrationsbetrieb in Niederbayern von oben gesehen © Friedhelm Dickow
Die bedrohte Feldlerche wurde in einem Frühsommer auf dem Demonstrationsbetrieb in Rheinhessen abgelichtet © Philip Hunke
Dieses Feldlerchenfenster befand sich auf dem Demonstrationsbetrieb in der Magdeburger Börde © Philip Hunke